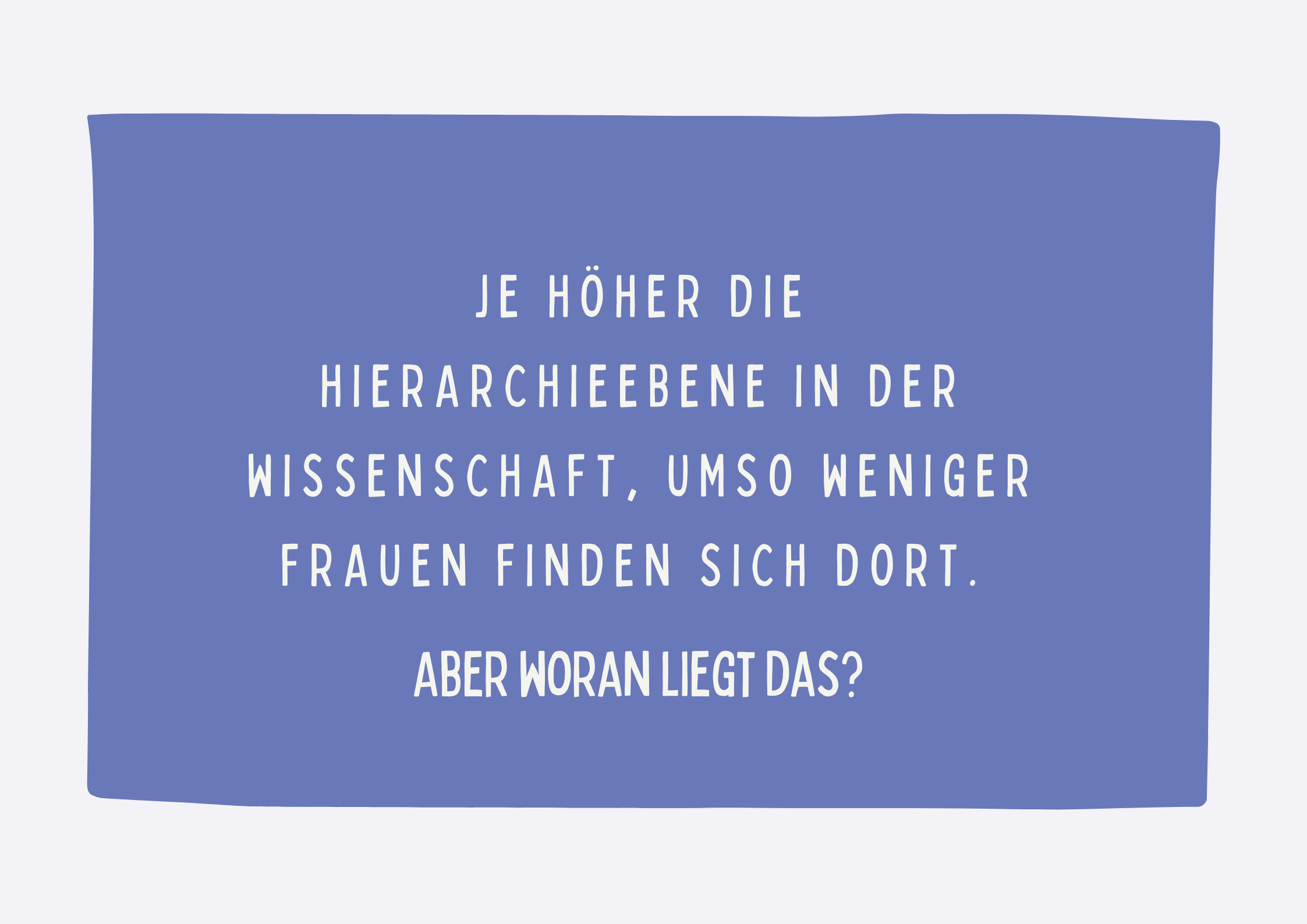Text: Alina Adrian
Hausarbeiten schreiben, im Labor stehen oder Tutorien leiten – manchmal merkt man im Studium schon, dass das Forschen und das Lehren und Lernen so viel Freude bereitet, dass der Gedanke aufkommt: Eigentlich will ich nicht mehr weg von der Universität!
Die akademische Laufbahn beginnt mit dem Bachelorstudium und endet im besten Fall mit der Berufung auf eine Professur. Die vielen Qualifizierungsschritte dazwischen – Master, Promotion und Habilitation, die Anstellung als wissenschaftliche Hilfskraft und später als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in – erfordern ein immenses Durchhaltevermögen und eine gute Portion Glück aufgrund der meist prekären Verhältnisse durch Abhängigkeiten von Drittmittel-Anträgen, der befristeten Stellen und der Abhängigkeit von Beziehungen und Netzwerken. Auf Twitter teilen derzeit viele Betroffene, wie es ihnen im Wissenschaftsbetrieb geht oder ergangen ist: #IchBinHanna #IchBinReyhan #ACertainDegreeOfFlexibility
Wer letztendlich auf den akademischen Spitzenpositionen, bspw. der Lebenszeit-Professur, sitzen darf, hängt jedoch von wesentlich mehr Faktoren ab als von der eigenen Leistung.
Obwohl in NRW die Studierendenschaft nach Geschlecht fast paritätisch aufgeteilt ist und sogar mehr Frauen als Männer das Bachelorstudium abschließen, besetzen nur ein Viertel, um genau zu sein 25,2 %, Frauen eine Professur.
Dieses Phänomen nennt sich in der Wissenschaft Leaky Pipeline und wurde 1983 von Sue E. Berryman in ihrer Studie „Who will do Science?“ geprägt.
Die Leaky Pipeline in NRW in Zahlen:
-
- Studierende: Männer 52,7 % und Frauen 47,3 %
- Absolvent*innen: 48,5 % Männer und 51,5 % Frauen
- Promovierte: 56,5 % Männer und 43,4 % Frauen
- Habilitierte: 72,4 % Männer und 27,6 % Frauen
- Professor*innen: 74,8 % Männer und 25,2 % Frauen
- W3-Professuren (mit Lehrstuhl): 76,5 % Männer und 23,5 % Frauen
Die Leaky Pipeline im Detail:
Schon bei den Absolvent*innen tut sich die erste Lücke auf: Im Verhältnis machen zwar mehr Frauen einen Bachelorabschluss, aber den Master schließen bereits mehr Männer ab (Männer: 51,9 %/Frauen: 48, 1%). Und ab da geht die Schere immer weiter auseinander. Rechnet man zum Beispiel Universitäten mit Klinikum und Hochschulmedizin als Fach raus, liegt die Quote der promovierten Frauen nur noch bei ca. 30 %.
Besonders in der sogenannten Post-Doc-Phase verlassen viele Frauen die Wissenschaft.
Lediglich bei den im Jahr 2002 eingeführten Juniorprofessuren lässt sich eine geschlechtergerechtere Berufungsquote feststellen (43,2 % Frauen bundesweit). Juniorprofessor*innen können ohne Habilitation berufen werden, um bereits nach der Promotion unabhängig zu forschen, und sparen sich damit eine weitere Qualifizierungsphase. Auch diese Stellen sind jedoch oft befristet und ohne Tenure-Track und damit nicht zwingend auf Entfristung ausgelegt. Die berufliche Zukunft bleibt also unsicher.
Auch wenn man verschiedene Fächer betrachtet, ist eines besonders auffällig: Der Unterschied zwischen einer nahezu paritätischen Aufteilung nach (binär gedachtem) Geschlecht innerhalb der Studierendenschaft und die Zahl der Frauen, die am Ende eine Professur besetzen.
In den Geisteswissenschaften, den Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und in der Humanmedizin bzw. den Gesundheitswissenschaften gibt es sogar weitaus mehr als 50 % weibliche Studierende. In keinem dieser Fächer gibt es annähernd so viele weibliche Professorinnen. Den größten Gap gibt es im Fach Humanmedizin, in dem zwar 66,8 % der Studierenden und 60,1 % der Promovierenden weiblich sind, letztendlich jedoch nur 20,9 % der Professuren von Frauen besetzt sind. Ausgenommen von dieser Form des Gender Gaps sind allein die Ingenieurwissenschaften, in denen es insgesamt nur wenig weibliche Studierende gibt (ca. ein Fünftel).
Zusammenfassend lässt sich feststellen: Je höher die Hierarchieebene in der Wissenschaft, umso weniger Frauen finden sich dort. Aber woran liegt das?
Die sogenannte Qualifikationsphase in der Wissenschaft ist oft ungemein prekär und unsicher und fällt oft mit der Phase der Familienplanung zusammen. In Deutschland wird der größte Teil der unbezahlten Sorgearbeit immer noch von Frauen getragen, d. h., sie kümmern sich in der Regel mehr um Kinder, nehmen länger Elternzeit und arbeiten danach oft Teilzeit oder pflegen bedürftige Verwandte. Die Wissenschaft sieht jedoch keine Teilzeitbeschäftigung für Professuren vor, wenn es um Care-Arbeit geht. Nebenbei beispielsweise ein Architekturbüro zu leiten und deswegen in Teilzeit eine Professur zu besetzen, ist allerdings durchaus üblich. Auch wenn in den einzelnen Qualifizierungsschritten als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in die meisten Stellen nur auf 50 % ausgelegt sind, liegt der Anspruch und die eigentliche Arbeitszeit meistens trotzdem bei 100 %.
Damit werden Frauen vor die Wahl gestellt: Wissenschaft oder Sicherheit bei der Familienplanung?
Dazu kommt die Problematik, dass Hochschulstrukturen und der Wissenschaftsbetrieb männlich und weiß dominiert sind.
Dies spiegelt sich auch in den Personalentscheidungen wider: Menschen neigen dazu, eher Menschen einzustellen, die ihnen ähnlich sind. Wenn also aufgrund von althergebrachten gesellschaftlichen Verhältnissen ein Großteil der Stellen auf Lebenszeit von weißen Männern besetzt sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass diese ebenfalls weiße Männer einstellen und weiterempfehlen. Diesen Effekt nennt man homosoziale Kooptation. Die Ungleichheiten des Systems reproduzieren sich damit selbst. Weniger Frauen werden berufen, weniger Frauen sitzen in den entscheidenden Gremien.
Dasselbe gilt für Menschen mit Behinderung, für People of Color und Menschen mit Migrationsgeschichte, für queere Menschen und für Kinder aus Arbeiter*innenfamilien. Die Wissenschaft als Arbeitswelt ist bisher ein ausschließendes System.
Was ist mit Gewalt?
Dass es in starken Abhängigkeitsverhältnissen schneller zu Machtmissbrauch und damit zu rassistischer oder sexualisierter Gewalt kommt, ist kein Geheimnis (hierzu ein Info-Text von Unser Campus). Gleichzeitig ist es stark tabuisiert, als Betroffene*r Erfahrungen öffentlich anzusprechen oder sich gar zu beschweren, da ansonsten die Aussicht auf eine weitere Vertragsanstellung in der Befristungskette gefährdet ist. Sexistische und rassistische Vorurteile machen auch vor der Uni keinen Halt, sodass sich mehrfach diskriminierte Menschen in der Wissenschaft einer besonders starken Belastung aussetzen müssen (hier zu insbesondere #IchBinReyhan).
Neben Gleichstellungsmaßnahmen an Hochschulen bräuchte es auch tiefergehende Diversity-Maßnahmen, von denen in der Wissenschaft
nicht nur weiße Frauen profitieren, sondern im Besonderen People of Color und Menschen mit Migrationsgeschichte. Durch das Fehlen marginalisierter Personengruppen in der Wissenschaft und an den Hochschulen entsteht eine Leerstelle, die nicht nur die Gegenwart beeinflusst, sondern auch zukünftige Forschung und Lehre und damit die zukünftige Gesellschaft. Ohne Vorbilder ist es für nachfolgende Generationen schwieriger, sich einen eigenen Platz an der Hochschule vorzustellen. Zudem werden damit Forschungsperspektiven ausgeblendet, die sich nicht als männlich und weiß positionieren.
Auch hier ist zu betonen: Die Unterrepräsentation queerer Menschen, Menschen mit Behinderung und Kindern aus Arbeiter*innenfamilien bestärkt diese Leerstelle um ein Vielfaches!
Es gibt also viel zu tun!
Hier einige Gleichstellungsmaßnahmen der RUB:
- Das Portal Changengleich
- Das Lore-Agnes-Programm
- WomenTor für Juniorprofessorinnen
- mentoring³ der Research Academy Ruhr (Karriereentwicklung für den weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchs)
- Women Professor Forum // Frauen leben Wissenschaft, für Professorinnen
- Familiengerechte Hochschule (Dezernat für Personal und Recht)
- Gleichstellungspläne der RUB
- Frauenparkplätze an der RUB Das Gleichstellungsbüro der RUB // Die Dezentralen Gleichstellungsbeauftragten der Fakultäten Die Gleichstellungskommission der RUB
[Die Zahlen beziehen sich auf den Gender Report 2019, der mit Zahlen aus dem Jahr 2017 arbeitet. Alle drei Jahre wird der Gender Report neu veröffentlicht, der nächste steht im Jahr 2022 an.]