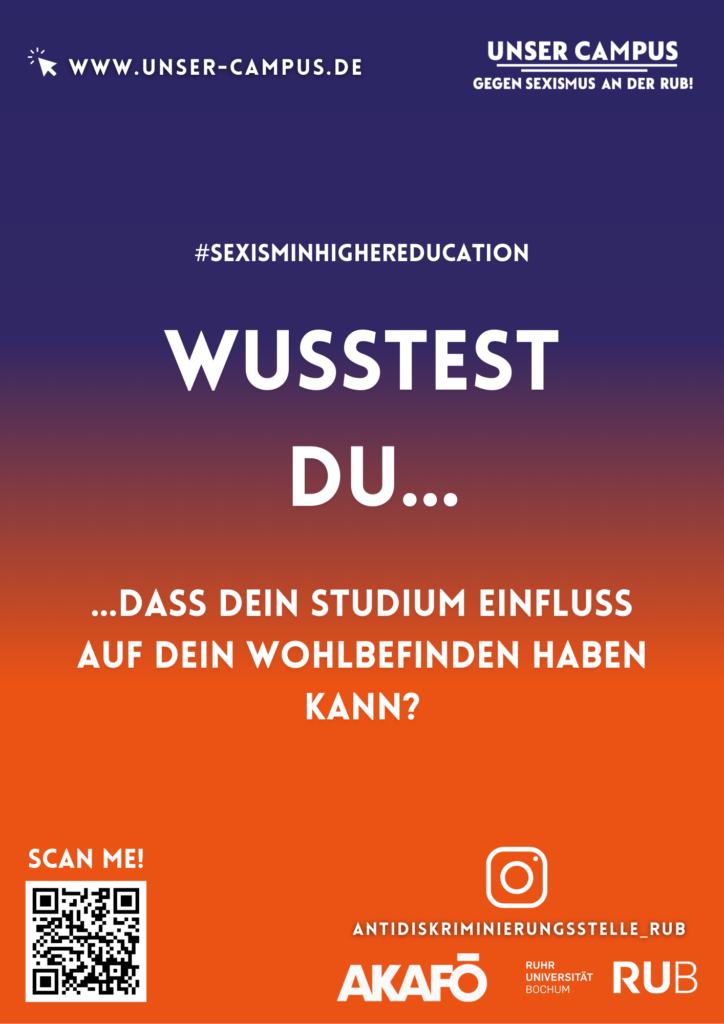
Kennst du das? Schon nach den ersten Semesterwochen schaust du auf deinen Kalender und weißt nicht, wie du das Schaffen sollst… Zu viele Kurse und zu viele Referate in zu kurzer Zeit und dann möchte man nebenbei auch noch ein Sozialleben führen. Außerdem muss noch die Klausurphase bewältigt werden. Und das alles am besten in Regelstudienzeit und mit guten Noten. Du erkennst dich darin wieder? Keine Angst, du bist damit nicht allein.
Eine 2017 durchgeführte Studie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, der Techniker Krankenkasse und der Freien Universität Berlin zeigt, dass jede vierte studierende Person in Deutschland davon berichtet, sich häufig sehr gestresst und erschöpft zu fühlen.[1] Der AOK Bundesverband hat 2016, eine in Kooperation mit der Universität Potsdam und der Universität Hohenheim entstandene Studie veröffentlicht, welche das bestätigt: 53% der befragten Student*innen gaben an, unter einem hohen Stresslevel zu leiden.[2] Diese Zahlen sind unter anderem die Folge von verschiedenen Faktoren, die viele Studierende täglich erleben, wie z.B. durch Prüfungsordnungen, Lehrende, Eltern und Kommiliton*innen konstruierter Leistungsdruck, Prüfungsangst, Zukunftsangst, Zeitdruck, Diskriminierungserfahrungen an Hochschulen, sowie (Selbst-)Zweifel und Überforderung mit dem Studium.
„Aber haben wir nicht alle mal Stress“? So einfach ist das leider nicht. Stress ist eine „Alarmreaktion des Körpers auf eine vermutete oder tatsächliche Gefahr“, welcher einen Hinweis ans Gehirn sendet, dass besonders viel Energie benötigt wird. Dadurch werden Stresshormone wie z.B. Noradrenalin, Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet und die 3 Phasen von körperlichen Anpassungsreaktionen gestartet[3]:
- Die Alarmreaktionsphase
Der Körper fängt an Stresshormone auszuschütten. Dadurch steigt die Herzfrequenz, der Blutzuckerwert und der Blutdruck an, die Atmung beschleunigt und die Bronchien erweitern sich und die Muskulatur wird mit Nährstoffen versorgt. Bei akutem Stress wird zusätzlich das Immunsystem aktiviert und Körperprozesse (z.B. die Blasentätigkeit) zurückgefahren.[4]
- Die Widerstandsphase
In der Widerstandsphase „versucht der Organismus sich an eine länger anhaltende Stresssituation, also chronischen Stress, anzupassen und den fortbestehenden Druck zu bewältigen“.[5] Typische Symptome in dieser Phase sind z.B. Bluthochdruck oder Verspannungen.
- Die Erschöpfungsphase
Mit der Erschöpfungsphase tritt gleichzeitig die Überforderung ein. Die Leistungsfähigkeit sowie die Funktionsfähigkeit werden auf Dauer schlechter, so dass man anfälliger für Krankheitserreger wird. Zusätzlich können psychische Erkrankungen wie Angststörungen oder Depressionen auftreten.
Ein über längere Zeit erhöhtes Stresslevel wirkt sich also negativ auf die psychische sowie auf die physische Gesundheit aus. So kann aus Stress in und nach der Erschöpfungsphase zu Schlafproblemen, Konzentrationsproblemen, Reizbarkeit, Niedergeschlagenheit, Verspannungen, Kopfschmerzen, Verdauungsproblemen, Magenschmerzen, Zähneknirschen und Atemnot entstehen. Diese Symptome können sich weiter zu physischen und chronischen Erkrankungen, wie beispielsweise einem Reizdarm- oder Reizmagensyndrom, einer Magenschleimhautentzündung, einem Magengeschwür oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, entwickeln.[6]
Eine im Dezember 2023 veröffentlichte und regelmäßig durchgeführte Studie mit dem Titel „best 3“ des Deutschen Studierendenwerks[7] zeigt, dass bei 22,6% der Studierenden mit psychischen Erkrankungen die Erkrankung erst nach Studienbeginn aufkam. Insgesamt äußerten 15,9% der befragten Studierenden, dass sie mit einer studienerschwerenden Beeinträchtigung leben – davon 65,2% mit psychischen Erkrankungen.
Studienerschwerende Beeinträchtigungen können dazu führen, dass man das Studium pausiert, abbricht oder das Studienfach wechselt. Laut der „best 3“-Studie von 2023 haben 21,3% der Studierenden mit einer psychischen Erkrankung bereits ihr Studium pausiert oder das Studienfach gewechselt, 28,3% die Hochschule und den Studienstandort gewechselt und 14,8% haben ihr Studium ohne Abschluss beendet.
2023 wurde eine Studie zu Diskriminierungserfahrungen von Studierenden an der Ruhr-Universität Bochum veröffentlicht, welche die Zahlen der „best 3“-Studie untermauert[8]. Laut der Studie der Ruhr-Uni Bochum haben 13% der befragten Student*innen eine studienerschwerende Beeinträchtigung, bei 65,8% der Beeinträchtigungen handelt es sich um psychische Erkrankungen. Außerdem zeigt die Studie, dass Studierende mit psychischen Erkrankungen deutlich häufiger von Diskriminierung am Campus betroffen sind (28,9%), als Studierende ohne psychische Erkrankungen (13,85%). Insgesamt haben 12,02% aller Studierenden mit psychischen Erkrankungen in ihrem Studienverlauf bereits Diskriminierung aufgrund ihrer psychischen Erkrankung erfahren. So entsteht schnell ein Teufelskreis, denn Diskriminierungserfahrungen lösen Stress aus, welcher wie oben beschrieben zu (weiteren) psychischen Erkrankungen führen kann. Aber müssten an der Stelle nicht die Hochschulen präventiv gegen Diskriminierung von Studierenden mit psychischen Erkrankungen vorgehen?
Die „best 3“-Studie zeigt, dass Studierende mit den Angeboten und Möglichkeiten für Studierende mit psychischen Erkrankungen an Hochschulen unzufrieden sind und selten einen Antrag auf einen sogenannten „Nachteilsausgleich“ stellen, da dieser mit vielen bürokratischen Hürden verbunden ist. Es braucht grundlegende Reformen des Hochschulapparats und gezielte Maßnahmen, um die Vereinbarkeit eines Studiums mit studienerschwerenden Beeinträchtigungen zu erhöhen als auch die gesundheitlich negativen Auswirkungen eines Studiums für Alle zu reduzieren. Notwendige Reformen wären beispielsweise Reformen von Prüfungsordnungen, die Erhöhung von Finanzierung und Ressourcen für (psychologische) Beratungsangebote sowie die Einführung von verbindlichen Fortbildungsmaßnahmen für Lehrende.
An der RUB gibt es u.a. bereits folgende Unterstützungsangebote und Beratungsmöglichkeiten für Studierende mit studienerschwerenden Beeinträchtigungen:
- Beauftragte für die Belange der Studierenden mit Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen
Die Beauftragte für die Belange der Studierenden mit Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen kümmert sich darum, dass die geltenden Rechtsvorschriften bei der Planung und Organisation der Lehr- und Studienbedingungen, beim Nachteilsausgleich für Studien- und Prüfungsleistungen und bei der Zulassung zum Studium ausreichend beachtet werden. Sie ist außerdem Ansprechpartnerin für Studierende bei Beschwerden.
- Autonomes Referat für Menschen mit Behinderungen und sämtlichen Beeinträchtigungen des AStA (AR-MBSB)
Das AR-MBSB des AStA der Ruhr-Universität Bochum ist Anlaufstelle für Menschen mit Behinderungen und sonstigen Beeinträchtigungen. Es vertritt die Interessen der Betroffenen und Angehörigen im Kontext der Ruhr Universität Bochum. Das autonome Referat wird durch gewählte Studierende vertreten.
- Die RUB hat auf mehreren Websites verschiedene Angebote und Termine zum Thema „Inklusion & Barrierefreiheit“ gesammelt, wie z.B. verschiedene Vernetzungs- und Austauschtreffen, Stammtische, Gesprächskreise und eine Übersicht mit spezifischen Beratungsangeboten. Diese findest du hier und hier.
- „Campus Neurodivers“ und „Sichtbar an der RUB“
Die studentischen Initiativen Campus Neurodivers und Sichtbar an der RUB engagieren sich, um das Studium an der RUB und die RUB insgesamt inklusiver zu gestalten.
- Peer Quartier / Psychologische Studienberatung
Das Peer Quartier und die psychologische Studienberatung bieten neben vertraulichen Beratungsangeboten verschiedene Workshops und regelmäßige Gruppenangebote an, um dich bei deinem Studium und der Studienorganisation zu unterstützen (z.B. Prüfungscoaching oder Kurse zu Public Speaking). Seit diesem Semester gibt es im Peer Quartier außerdem das Peer-to-Peer-Mentoring-Programm „P2P-Inklusiv“ für Studierende mit sichtbarer/nicht-sichtbarer Behinderung und/oder chronischer Erkrankung. Weitere Infos findest du hier.
- Safer Spaces
An der RUB werden regelmäßig von verschiedenen Akteur*innen, wie z.B. von der Antidiskriminierungsstelle, von BIPoC denken oder von Unser Campus, Safer Spaces für verschiedene Gruppen angeboten.
- Zentrum für Wissenschaftsdidaktik
Im Zentrum für Wissenschaftsdidaktik findest du Angebote, die dir im Studium dabei helfen, Texte zu verfassen, deine Kurse zu organisieren und dich auf Prüfungen vorzubereiten. Diese Kurse können dir dabei helfen, die Angst vor verschiedenen Aufgaben und Abgaben, sowie deinen Studienstress zu reduzieren.
Du vermisst ein Angebot, dass wir noch nicht kennen oder vergessen haben? Dann schreib uns doch gerne eine Mail an unsercampus@rub.de und wir nehmen dieses hier noch nachträglich auf.
Zusätzlich ist leider auch der Campus kein Ort, der frei von Sexismus- und Diskriminierungserfahrungen wäre. Beides wirkt sich – wie oben beschrieben – ebenfalls negativ auf die psychische sowie physische Gesundheit aus. UNSER CAMPUS hat im Wintersemester 23/24 dazu bereits ein Plakat mit einem dazugehörigen Artikel erstellt, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Diesen findet ihr hier.
Du hast an der RUB-Diskriminierung und/oder Sexismus erfahren oder beobachtet? Ansprechpartner*innen, Unterstützung und Beratung findest du zum Beispiel hier:
- Antidiskriminierungsstelle der RUB
Bei was wird beraten? Die Antidiskriminierungsstelle der RUB ist die zentrale Beratungs-, Vermittlungs- und Informationsstelle für Studierende, Mitarbeitende und andere Angehörige der Universität, die Diskriminierung erleben, beobachten und Fragen oder Unterstützungsbedarf zum Thema haben.
In welchen Sprachen wird beraten? Deutsch und Englisch
Terminabsprache: Ab 2024 gibt es regelmäßige Sprechstunden. Diese finden jeden Mittwoch von 10:00 bis 12:00 Uhr statt. Anmeldungen bitte vorab unter: antidiskriminierung@rub.de
- Zentrales Gleichstellungsbüro der RUB
Bei was wird beraten? Das Gleichstellungsbüro und die Zentralen Gleichstellungsbeauftragen sind die Ansprechpartner*innen an der RUB für alle Themen rund um Gleichstellung und Chancengleichheit. Auch bei Diskriminierungserfahrungen aufgrund der sexuellen Identität und des Geschlecht ist das Gleichstellungsbüro die beratende Anlaufstelle.
In welchen Sprachen wird beraten? Deutsch & Englisch
Terminabsprache: Individuelle Terminvereinbarung per Mail. Weitere Infos dazu hier. Eine Beratung per Zoom ist ebenfalls möglich!
- Psychologische Studienberatung
Bei was wird beraten? Die Psychologische Studienberatung unterstützt bei Schwierigkeiten von Studierenden und im Umgang mit Studierenden in schwierigen Beratungssituationen, ist Ansprechpartnerin für Krisenfälle bei Studierenden, bietet Informationsveranstaltungen zum Thema (psychisch) Gesund studieren an und schult zum Thema: „Erste Ansprechpartner in Krisenfällen – Was tun?“
In welchen Sprachen wird beraten? Deutsch, Englisch & Spanisch (Bitte bei der Terminvereinbarung die gewünschte Sprache mit angeben.)
Terminabsprache: per Mail an psychberatung@rub.de und telefonisch
Montags, zwischen 9-10 Uhr unter 0234 32 22343
Mittwochs, zwischen 13-14 Uhr unter 0234 32 23884
Freitags, zwischen 9-10 Uhr unter 0234 32 23860
Die Berater*innen unterliegen der Schweigepflicht.
Quellen:
Deutsches Studierendenwerk: „Viel mehr Studierende mit psychischen Erkrankungen“
https://www.studierendenwerke.de/beitrag/viel-mehr-studierende-mit-psychischen-erkrankungen (zuletzt abgerufen am 30.03.2025)
Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, Techniker Krankenkasse, Freie Universität Berlin: „Faktenblatt zur Befragung „Gesundheit Studierender in Deutschland 2017““
https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/psychologie/arbeitsbereiche/ppg/forschung/BwB/bwb-2017/_inhaltselemente/faktenblaetter/gesundheit/FB_Stress.pdf (zuletzt abgerufen am 02.04.2024).
Forschung & Lehre: „Wie belastet sind Studierende?“
https://www.forschung-und-lehre.de/zeitfragen/wie-belastet-sind-studierende-6268 (zuletzt abgerufen 30.03.2025)
Freie Universität Berlin: „Zum Zusammenhang zwischen Studium und Gesundheit“
https://www.fu-berlin.de/sites/healthy-campus/interventionsmanual/interventionsbeschreibungen/Website_Zum-Zusammenhang-zwischen-Studium-und-Gesundheit.pdf (zuletzt abgerufen am 30.03.2025)
gesund.bund: „Stress: Auswirkungen auf Körper und Psyche“ https://gesund.bund.de/stress (zuletzt abgerufen am 02.04.2025)
Hans Alves u.a.: „Studie zu Diskriminierungserfahrungen unter Studierenden der Ruhr-Universität Bochum“ https://news.rub.de/sites/default/files/diskriminierungserfahrungen_unter_studierenden.pdf (zuletzt abgerufen am 04.04.25)
Julia Steinkühler u.a.: „Die Studierendenbefragung in Deutschland: best3. Studieren mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung“, Dezember 2023 https://www.studierendenwerke.de/fileadmin/user_upload/beeintraechtigt_studieren_2021.pdf (zuletzt abgerufen am 31.03.2025)
Uta Herbst, u.a.: „Studierendenstress in Deutschland – eine empirische Untersuchung https://www.uni-heidelberg.de/md/journal/2016/10/08_projektbericht_stressstudie.pdf (zuletzt abgerufen am 02.04.2025)
SWR Wissen: „Psychische Erkrankungen: Zu wenig Unterstützung für Studierende“
https://www.swr.de/wissen/anteil-psychischer-erkrankungen-bei-studierenden-stark-angestiegen-100.html#:~:text=Immer%20mehr%20Studierende%20haben%20mit,Ende%20der%20Pandemie%20förmlich%20überrannt (zuletzt abgerufen am 30.03.2025)
[1] Vgl.: Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, Techniker Krankenkasse, Freie Universität Berlin: „Faktenblatt zur Befragung „Gesundheit Studierender in Deutschland 2017“ (https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/psychologie/arbeitsbereiche/ppg/forschung/BwB/bwb-2017/_inhaltselemente/faktenblaetter/gesundheit/FB_Stress.pdf , zuletzt abgerufen am 02.04.2024).
[2] Uta Herbst, u.a.: „Studierendenstress in Deutschland – eine empirische Untersuchung (https://www.uni-heidelberg.de/md/journal/2016/10/08_projektbericht_stressstudie.pdf , zuletzt abgerufen am 02.04.2025)
[3] Vgl.: gesund.bund: Stress: Auswirkungen auf Körper und Psyche (https://gesund.bund.de/stress , zuletzt abgerufen am 02.04.2025)
[4] Vgl.: gesund.bund: Stress: Auswirkungen auf Körper und Psyche (https://gesund.bund.de/stress , zuletzt abgerufen am 02.04.2025)
[5] Vgl.: gesund.bund: Stress: Auswirkungen auf Körper und Psyche (https://gesund.bund.de/stress , zuletzt abgerufen am 02.04.2025)
[6] Vgl.: gesund.bund: Stress: Auswirkungen auf Körper und Psyche (https://gesund.bund.de/stress , zuletzt abgerufen am 02.04.2025)
[7] Julia Steinkühler u.a.: „Die Studierendenbefragung in Deutschland: best3. Studieren mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung“, Dezember 2023 (https://www.studierendenwerke.de/fileadmin/user_upload/beeintraechtigt_studieren_2021.pdf, zuletzt abgerufen am 31.03.2025).
[8] Hans Alves u.a.: Studie zu Diskriminierungserfahrungen unter Studierenden der Ruhr-Universität Bochum (https://news.rub.de/sites/default/files/diskriminierungserfahrungen_unter_studierenden.pdf ; zuletzt abgerufen am 04.04.25)

